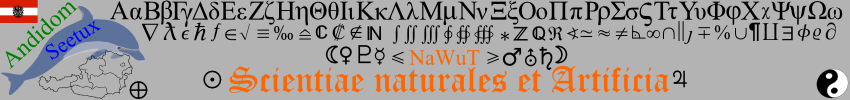Anleitung zum Entwurf eines Nomogramms der Zenitdistanzen.
Mit dem Nomogramm lassen sich auf einfachste Weise die Zenitdistanz bzw. die Höhe eines Sterns von bekannter Deklination bei einem bestimmten Stundenwinkel ermitteln.
Skalen
Die linke Skala (t) enthält den Stundenwinkel (t), das ist der zeitliche Abstand von der oberen Kulmination. Er ist hier von 0h (obere Kulmination) über 6h bis 12h (untere Kulmination) und dann weitergezählt über 18h (bürgerliche-, Nautische-, Astronomische Dämmerung) bis wieder zur oberen Kulmination 24h = 0h.
t ist der Stundenwinkel, den man auch von 0h bis +12h für westlich vom Meridian befindliche Gestrine und von -12h bis 0h für östlich davon stehende Gestirne angeben kann. Die Beschriftung erfolgt dann von unten mit 0h und geht nach oben über ±1h, ±2h usw. bis oben ±12h. ±12h bedeutet die untere Kulmination (im Norden), positive Werte gelten nach, negative Werte vor der oberen Kulmination.
Die mittlere gekrümmte Skala zeigt die Deklination von +90° bis -40°. Legt man eine Gerade (Lineal) so durch die beiden Leitern, dass sie bei einem angenommenen Stundenwinkel und der Deklination des Sterns schneidet, so ergibt der Schnittpunkt ihrer Verlängerung auf der rechten Skala (z, h) die Zenitdistanz bzw. Höhe des Sterns für den angenommenen Stundenwinkel.
Wird die z-Skala nach unten für z > 90° verlängert, kann man auch die für Dämmerungsbeobachtungen wichtige Sonnendepression (Tiefe der Sonne unter dem Horizont (6,5°, 18°)) bestimmen.
Berechnung und Nullpunkte
Die hier dargestellten Formeln stammen von P. Luckey in der bis 1926 erschienenen Zeitschrift "Sirius" und wurden im Jahrgang 1922 veröffentlicht. Mit diesen Formeln ist es möglich ein Nomogramm für jede beliebige Breite zu zeichnen und somit genau seinen Bedürfnissen anzupassen.
Zur Berechnung sind die Stundenwerte in Bogengraden zu verwandeln: 1h = 15°. Als Zwischenwerte kann man 10min = 2,5° graphisch interpolieren oder zur Sicherheit auch noch die halbstündlichen Werte errechnen, Für die δ-Skala genügt eine Rechnung von 10° zu 10°, für die Zenitdistanzen geht man zweckmäßig von 5° zu 5°. Die berechneten Punkte werden auf das Milimeterpapier übertragen und an der δ-Skala mit Hilfe eines Kurvenlinieals verbunden.
t-Skala (links)
xt = 0, yt = -b cos t
z-Skala (rechts)
xz = a, yz = b(2 cos z - 1)
δ-Skala (Mitte)
xδ = x-Achse der Deklination = xδ = a / (1 + 2 * cos(φ) * cos(δ))
yδ = y-Achse der Deklination = yδ = b * (2 * sind(φ) * sin(δ) - 1) / (1 + 2 * cos(φ) * cos(δ))
Nullpunkte
Die Nullpunkte der y-Koordinaten der t-Skala und z-Skala liegen bei t=6h (18h) und z = 60° (h = 30°)
Konstanten a und b
Für den Abatand (a) der beiden senkrechten Leitern wählt man für Millimeterpapier im Format A4 160 mm, für b = Halbe Länge der beiden senkrechten Skalen (120mm). Hat man größere Formate zur Verfügung, kann man a und b größer nehmen, doch sollte das Verhältnis der Konstanten a : b nahe bei 4 : 3 liegen.
Verhältnis der Konstanten: a : b = 4 : 3
Formelzeichen
Geographische Breite = φ
Zenitdistanz = zd
Höhe = h
Quelle: Kleine praktische Astronomie ISBN - 3335000005